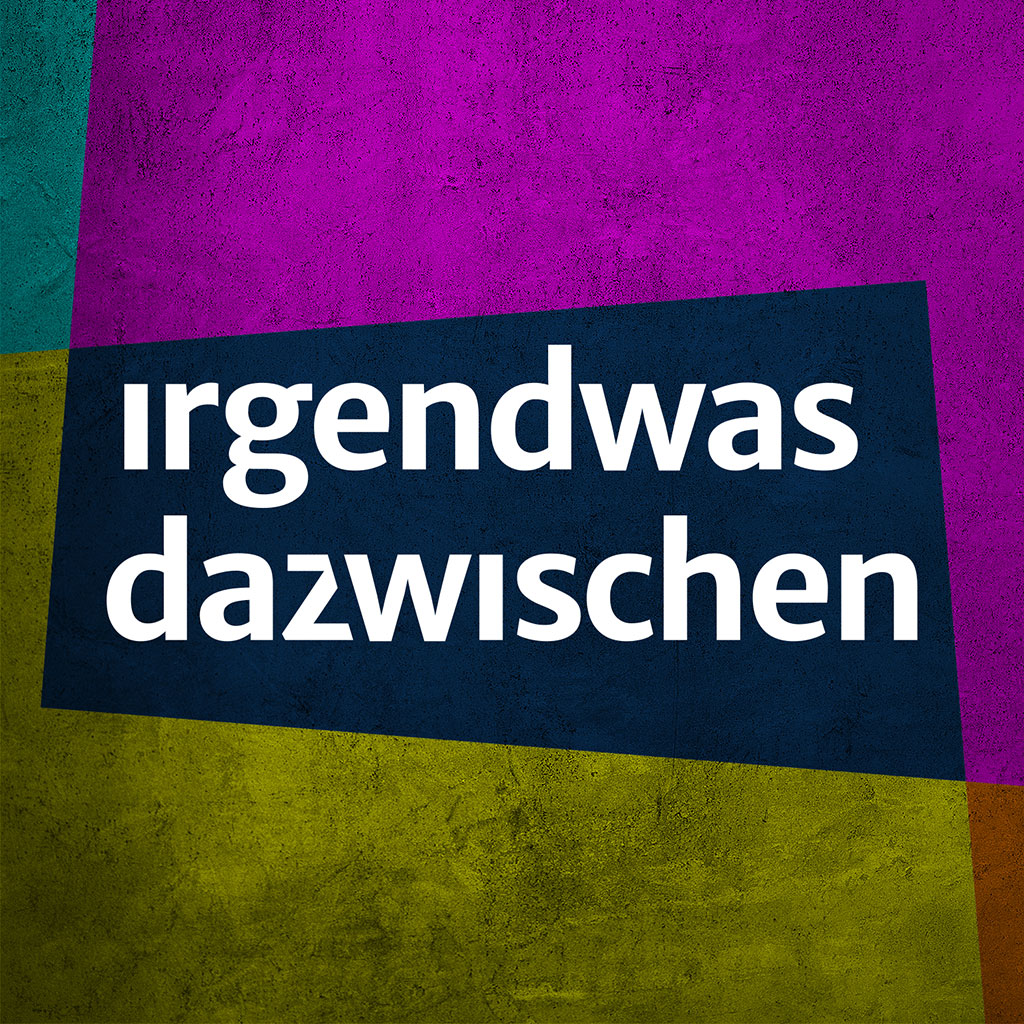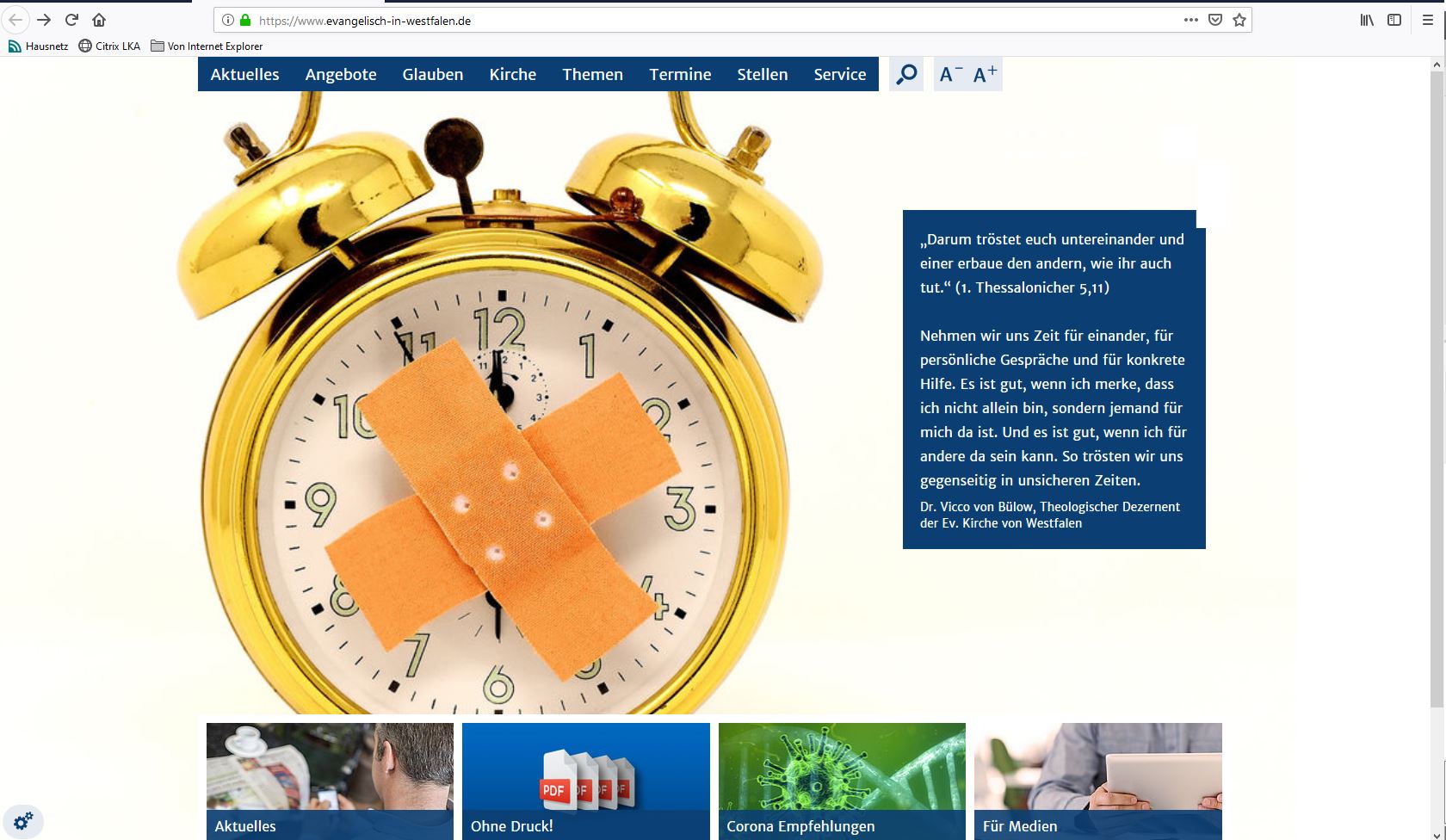the martin luther suite – a jazz reformation
NDR Bigband unter der Leitung von Stefan Pfeifer-Galilea
Arrangements: Lucas M. Schmid – Komp.: Diverse
Aufführung am 30.10.2014 in der Auferstehungskirche Bad Oeynhausen
im Rahmen von KuK! – Kirche und Kultur des Evangelischen Kirchenkreises Vlotho
Moderation: Vicco von Bülow
Am Anfang war … Blitz und Donner.
Als Martin Luther im Jahr 1505 auf dem Weg nach Erfurt den Ort Stotternheim passierte, brach ein gewaltiges Gewitter los. Die Geschichte erzählt, dass ein Blitz dicht neben Luther einschlug. In Todesangst soll er gerufen haben: „Hilf heilige Anna, ich will ein Mönch werden.“
Die Reformation ist eine Geschichte der Befreiung aus der Angst. Ein Schritt auf dem Weg in die Freiheit.
Luther selbst hat von sich als „Madensack“ gesprochen.
Aber: Wenn man die Wirkung betrachtet, steht Martin Luther im Mittelpunkt der Reformation.
Deshalb ist eine Martin Luther-Suite mehr als angebracht.
Lucas Schmid hat sie komponiert, seinerzeit noch Musiker bei der NDR-Bigband. .
Martin Luther hat einmal gesagt: „Die Musica ist eine schöne und herrliche Gabe Gottes.“ Jazz kannte er nicht. Aber wir werden heute hören, wie a jazz reformation klingt und ich werde ein paar Gedanken zur Verbindung von Musik, von Jazz und von Reformation mit Ihnen teilen.
Auch der Komponist des heutigen Abends hat sich Gedanken zu dieser Verbindung gemacht. Lucas Schmid sagt:
Eine Brücke zu schlagen und die reformatorische Musik in das schöpferische, junge Idiom des Jazz zu transportieren, empfand ich als aufregendes Unterfangen. Wie viele Musikgattungen, so ist auch der Jazz aus einem „Schmelztiegelprozeß“ entstanden. Eine der Schmelztiegelbestandteile ist der Gospel, ein Kirchenlied.
Eine andere die Improvisation, in der Kirchenmusik von Organisten über mehrere Jahrhunderte praktiziert. Wohl in höchster Vollendung beherrschte Johann Sebastian Bach die Improvisation, seine Bearbeitungen der Luther Choräle für Orgel sind allgemeines Kulturgut.
Den raumfüllenden Klangeindruck einer Orgel auf eine Bigband zu übertragen, lag auf der Hand. Dieses große Ensemble verfügt ebenfalls über eine Fülle von Klangfarben, zudem ist es mit wunderbaren Improvisatoren besetzt. Die Musik von Luther läßt bei der Bearbeitung viel Ausdrucksfreiheit zu. Diese findet man im Jazz wieder, erweitert durch die Soloimprovisation.
Als Musiker der NDR Bigband war mir die Möglichkeit gegeben, die auf Partitur geschriebene – stumme – Musik in Klang umzusetzen. Das aufregende Unterfangen kulminiert mit der aufregenden Erfahrung der Aufführung.
1. STOTTERNHEIM 1505
Komp./Arr. : Lucas M. Schmid
„Hilf heilige Anna, ich will ein Mönch werden.“ Dieser Satz bestimmt das erste Motiv. Die Zielnote, also die höchste Note, erklingt bei „Mönch“. Luther hielt Wort, er wurde Mönch und nicht Rechtsgelehrter, trotz der Empörung seines Vaters und der Familie. Am Ende von „Stotternheim 1505“ hört man einen langen tiefen Ton, der das Einstimmen der Mönche beim Chorsingen und damit den Eintritt ins Augustinerkloster andeutet.
Dass Luther in einen Orden in der Tradition des spätantiken Kirchenvaters Augustinus eintrat, hat die weitere theologische Entwicklung mitbestimmt. Martin Luther hat sein Leben als Teil einer religiösen Leistungsgesellschaft gedeutet. Durch eine besondere Intensität religiöser Leistung sollte das Anrecht auf ein gnädiges göttliches Urteil im Endgericht verstärkt werden. Wir wissen, dass Luther als Mönch in Erfurt so viele Sunden bei sich aufzuspüren suchte und beichtete, dass es seinem Beichtvater Johann von Staupitz zur Last wurde. Ja, er zweifelte, ob es sich wirklich um Sünden handele. Solche Erfahrungen machen heute nur noch Menschen in bestimmten religiösen Milieus, sie sind kein für heutige Mehrheitsfrömmigkeit charakteristisches Verhalten. Uns ist auch das übersteigerte spätmittelalterliche und frühreformatorische Bild von Gott als einem Gerichtsherrn, der wie ein absolutistischer Monarch unumschränkt herrscht, tief problematisch geworden. Es entspricht in seiner Einseitigkeit weder dem, was Jesus von Nazareth über seinen Vater lehrt, noch dem, was viele Passagen des Alten Testaments über den Gott Israels verkünden.
Bedeutsam bis heute ist aber, dass Martin Luther sehr selbstkritisch im Blick auf seinen eigenen Lebensweg formuliert hat, dass sein Ringen um das Heil letzten Endes von purem Egoismus geprägt war. Er erkannte nämlich, dass es ihm insbesondere beim Beichten nicht um Gott, sondern um ihn selbst und seine persönliche Rettung ging. Mit seiner Vorstellung, eine vor Gottes Richterstuhl akzeptable religiöse Leistung erbringen zu können, stellte er sich selbst Gott als eine gleichwertige Größe gegenüber. Gerade eben so, als ob vor einem imaginären Dritten zwei auf derselben Stufe stehende Parteien über ihre Anspruche gegeneinander verhandeln wurden. Als Mönch in der Tradition Augustins wusste Luther aber, dass der Mensch lieber selbst Gott sein will, als zu erkennen, wie wenig perfekt er durch sein Leben stolpert.
Das Bemühen um die Vergebung der Sünden nennt die christliche Tradition „Buße“.
Am 31.10.1517 (also vor fast 497 Jahren) veröffentliche Martin Luther seine berühmt gewordenen 95 Thesen gegen den Ablass. In der ersten beschreibt er sein Verständnis von Buße: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht „Tut Buße“ u.s.w. (Matth. 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.
Ein weiterer zentraler Punkt in der Frühgeschichte der Reformation war Luthers Auftritt vor Kaiser und Reich beim Reichstag in Worms am 18. April 1521.
Lange war die Erinnerung daran durch die Überlieferung geprägt, dass der Reformator seine Rede mit den Worten schloss: „Ich kan nicht anderst, hie stehe ich, Gott helff mir. Amen.“ Damit gab der Reformator vor allem in den nationalen Erinnerungskulturen ein Beispiel für protestantische Standhaftigkeit gegen autoritäre Zumutung. Inzwischen hat sich durchaus die Einsicht im kulturellen Gedächtnis verbreitet, dass Luther seine Wormser Rede höchstwahrscheinlich anders geschlossen hat. Die Erinnerung an diesen authentischen Schluss im Zusammenhang des Jubiläums 2017 ist keine bloße historische Besserwisserei. Sie zeigt vielmehr, dass Luther 1521 erstmals an prominenter Stelle das für die europäische Neuzeit so überaus bedeutsame Thema der Gewissensfreiheit eines Einzelnen gegenüber institutionellen Zwängen prominent zur Geltung brachte. Luther sagte damals: „derhalben ich nicht mag noch will widerrufen, weil wider das gewissen zu handeln, beschwerlich, unheilsam und (ge)ferlich ist. Gott helf mir! Amen.“
Luthers Rede von 1521 war keine feierliche Erklärung der Gewissensfreiheit im modernen Sinne eines allgemeinen Menschenrechts. Er wusste sein Gewissen, wie er selbst kurz vor dem zitierten Schluss seiner Rede sagte, „durch die Worte Gottes gefangen“. Aber er drückte mit seinen Worten seine feste Überzeugung aus, dass weltliche Macht ihre Grenzen an eben diesem Gewissen findet, durch das er selbst sich unmittelbar vor Gott gestellt sah.
2. NU FREUD‘ EUCH LIEBE CHRISTEN GMEIN
Komp.: Martin Luther
Arr.: Lucas M. Schmid
Luthers erstes Gemeindelied aus dem Jahre 1523.
Wurde im ersten evangelischen Liederbuch, dem Achtliederbuch veröffenlticht. Steht heute noch im Evangelischen Gesangbuch.
Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
und lasst uns fröhlich springen,
dass wir getrost und all in ein
mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat
und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.
(EG 341,1)
Der Einstimmton erklingt wieder. Die Solotrompete spielt den Choral an und das Orchester – die Gemeinde – antwortet. Der Charakter dieses Stückes tendiert zum „Latin feel“ oder besser gesagt „Salsa“; im übertragenen Sinn einer Form, in der die verschiedensten (Musik-) Strömungen frei von Vorurteilen angenommen und verarbeitet werden.
3. LOBGESANG: NU BITTEN WIR DEN HEILIGEN GEIST
Komp.: Alte deutsche Weise
Arr.: Lucas M. Schmid
1. Nun bitten wir den heiligen Geist
Um den rechten glauben allermeist,
Daß er uns behüte an unserm ende,
Wenn wir heimfahren aus diesem elende.
Kyrieleis!
Der Heilige Geist, für uns oft nur schwer greifbar, wurde von Luther in diesem Lied mit verschiedensten Worten angeredet:
2. Du werthes licht!
3. Du süße lieb‘!
4. Du höchster tröster in aller noth!
(EG 124)
Der Heilige Geist ist in biblischer Perspektive schon bei der Entstehung des Lebens wirksam – er schwebte über den Wassern -, er bewirkt neue Lebensaufbrüche und überschreitet das Vorgegebene in seiner Regelhaftigkeit. Gott haucht seinen Geist allem Leben ein, erfüllt es so mit seiner heilsamen Präsenz und bleibt zugleich Subjekt alles Lebendigen. Die dynamische Präsenz des Geistes zeigt sich in der Pfingstgeschichte, wenn vorgegebene Sprache in ihrer verbindenden Gestalt, aber auch ihrer Begrenztheit gegenüber anderem überschritten wird und im Hören, aber auch im Sprechen neue, ungeahnte Verständigung ermöglicht wird.
Als Luther die Kirche in Rom angriff, rief er: „Nun helfe uns Gott und gebe uns der Posaunen eine, mit der die Mauern Jerichos wurden umgeblasen, damit auch wir diese strohernen und papiernen Mauern (Widerstand der Römischen Kirche) umblasen…“ Diesem Ausruf folgend, steht die Posaune im Mittelpunkt des Arrangements.
Das von der Gospelmusik inspirierte Stück steht im 5/4 Takt.
4. PATREM
Komp.: Nikolaus von Kosel
Arr.: Lucas M. Schmid
Die Melodie stammt aus dem 15. Jahrhundert. Sie steht zuerst über einem Credo in einer Handschrift von 1417 in Breslau und weist als Autor Nikolaus von Kosel aus. Nikolaus von Kosel (1390-1423) war ein schlesischer Franziskaner-Minorit. Er gilt als der früheste deutsche Schriftsteller Oberschlesiens und war geprägt durch eine Marien- und Heiligenfrömmigkeit. Luther übernahm seine Melodie und versah sie mit einem neuen, christuszentrierten Text. So wandt er sich gegen das Anbeten der Heiligen.
Vgl Art. 21 der Confessio Augustana von 1530: „Vom Dienst der Heiligen“:
„Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, daß man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf.* Aus der Hl. Schrift kann man aber nicht beweisen, daß man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll. […]“
Das Altsaxophon übernimmt in diesem Stück den Solopart. Das Orchester setzt in den Fermaten ein und verleiht dem Credo verschiedene Stimmungen als Synonym für Zustand, Entwicklungen, Phasen. Die Soloimprovisation des Altsaxophons zerrt diese Stimmungen in die Extreme.
5. VOM HIMMEL HOCH – EIN KINDERLIED Komp.: vermutlich aus dem Niederdeutschen
Arr.: Lucas M. Schmid
Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singn und sagen will.
(EG 24,1)
Hier heißt es von der gute Mär, also von der frohen Botschaft, vom Evangelium „Davon ich singen und sagen will…“ Davon ich singen und sagen will – in der Reihenfolge: Musik als erstes Medium der Verkündigung!
Davon ich singen und sagen will: Also, erst das Singen, dann das Sagen – erst die Performance, dann das kognitive Verstehen – oder wenn Sie es auf den Glauben übertragen wollen: Glaube ist zuallererst Vertrauen, kindliches Zutrauen, und dann erst Wissen und Verstehen. Dieser Vorgang ist für den christlichen Glauben grundlegend.
Der Ausruf des Orchesters „Susanine!“ spielt auf die 14. Strophe von Luthers Text an und bezeichnet ein veraltetes Wort für ein Wiegenlied, das heute nur noch hier vorkommt.:
Davon ich allzeit fröhlich sei,
Zu springen, singen immer frei
Das rechte Susaninne schon,
Mit Herzenslust den süßen Ton.
(EG 24,14)
6. KATHARINA VON BORA / AMOUR FOU Komp./Arr.: Lucas M. Schmid
Am 13. Juni 1525 heiratete Luther Katharina von Bora. Diese Jazz-Ballade spielt darauf an, dass beide es sich zu Beginn nicht leicht gemacht haben. Zunächst hielt Luther die Tochter aus verarmtem Rittergeschlecht für hochnäsig. Dennoch nahm er sie aus Vernunftgründen zur Frau: Sie war eine ehemalige Nonne, die aus ihrem Kloster entflohen war. Die Hochzeit eines ehemaligen Mönchs mit einer ehemaligen Nonne war ein kräftiges Symbol gegen die von Luther abgelehnte Verpflichtung zum Zölibat.
Dass aber dann auch die Emotionen erwachten, ist eine wunderbare Weiterentwicklung der Geschichte. Ja, sie lernten sich nicht nur kennen, sondern auch lieben. Und das offene Haus, das sie führten und das unter Katharinas Leitung stand, wurde zum Modell für das evangelische Pfarrhaus der letzten fünf Jahrhunderte. Katharina von Bora wurde zu der „Lutherin“ (Eva Zeller). Und sie erinnert uns heute stellvertretend an die Frauen, die im 16. Jahrhundert die Reformation vorangetrieben haben. Und in deren Erbe die Frauen stehen, die seit 40 Jahren in unserer Landeskirche als Pfarrerinnen ordiniert wurden. Frauen, die dann auch als Superintendentin oder als Präses Leitungsverantwortung in unserer Kirche übernommen haben.
Martin Luther hat in seiner großen Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ formuliert: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“
Es geht nicht darum, über Freiheit nur zu reden, sondern darum, die Freiheit zu leben.
Musikalisch baut sich anfangs eine Spannung auf , die sich dann in einen liegenden Ton, nämlich D, auflöst. Dieser Vorgang findet mehrmals im Stück statt und deutet auf die Spannung, die sich in einer anfänglichen Liebesbeziehung aufbaut, ein Stau der Gefühle, sozusagen ein Kribbeln im Bauch, und dann kommt der erlösende , entspannende Moment , der diese positive Spannung wohltuend auflöst. Die Entspannung kann das Erwidern der Gefühle sein , ein verzückter Blick, oder ein Lächeln, ein Erwidern der Gefühle.
7. GOTT DER VATER WON UNS BEY
Komp.: deutsche Litanei aus dem 15. Jhr. von Luther bearbeitet Arr.: Lucas M. Schmid
1. Gott der Vater wohn uns bei
und lass uns nicht verderben,
Mach uns aller Sünden frei
und hilf uns selig sterben,
für dem Teufel uns bewahr,
halt uns bei festem Glauben […]
Amen, Amen, das sei war,
so singen wir Halleluia.
2. Jesus Christus wohn uns bei etc.
3. Heilig Geist der wohn uns bei etc.
Der trinitarische Aufbau des Liedes (das als eines der wenigen Luther-Lieder nicht im EG abgedruckt wurde) inspiriert zu einer trinitarischen Deutung der Musik,
Gott der Vater wohn uns bei: Musik ist eine Gabe des Schöpfers, die von seiner Weisheit und Phantasie kündet. Sie ist eine freie Kunst, die uns Menschen zur Gestaltung anvertraut ist. Musik stiftet Beziehung. Sie kann Ausführende und Zuhörer mit Freude erfüllen, ja sogar den Schöpfer verherrlichen.
Jesus Christus wohn uns bei: Das Evangelium ist kein papiernes Lesewort, die frohe Botschaft von Jesus Christus ist ein sinnliches Klangereignis. Deshalb nimmt die christliche Kirche die Musik als Gabe Gottes an und lässt sich durch sie bewegen und anreden. Als klingendes Wort Christi lädt die Kirchenmusik Menschen zum Glauben ein, tröstet und vergewissert. Klagend und lobend, flehend und dankend gibt sie dem dreieinigen Gott die Ehre,
Heilig Geist der wohn uns bei: Gottes Geist ist „Poet und Kantor.“ Er macht die natürliche Gabe der Musik zu einem Instrument, das Gott die Ehre gibt und Glauben schafft, Gemeinschaft stiftet und tröstet, aber auch provoziert und anregt. Kirchenmusik bietet einen vielfältigen Beitrag zur Gegenwartskultur, sie schafft auch ein Stück „Gegenkultur zum Zeitgeist“. Sie geht aber auch nicht gänzlich an den Hörgewohnheiten und Erwartungen der Menschen vorbei.
Lucas Schmid hat die Anmerkung „…von Luther bearbeitet…“ zum Anlass genommen, die Bearbeitung dieses Stückes fortzusetzen.
Um dem vorgegebenen alla breve gerecht zu werden, finden Wechsel zwischen einem schnellen 3/4 Takt und einem medium Swing 4/4 Takt statt. Wer den Text zur Melodie kennt, wird bemerken, das der Textabschnitt „Gott der Vater won uns bey…“ in einer strahlenden Dur Farbe erscheint und dass einige Takte später im Abschnitt „…für dem Teufel uns bewar…“ die Melodie in Moll ertönt.
8. HYMNUS / NU KOMM DER HEIDEN HEILAND Komp.: Altlateinisches Lied, Text Luther nach nach dem Hymnus veni redemptor gentium des Ambrosius von Mailand um 386
Arr.: Lucas M. Schmid
Luther durchlebte auch die Einsamkeit, den quälenden Selbstzweifel, die fast selbstzerstörerische Askese und äußerst labile Gemütszustände.
Seinen Trost fand er im Blick auf Jesus Christus. Er war Luther das Licht im Dunkel der Seelennacht. Von der Geburt Jesu, also von der Menschwerdung Gottes, erzählt dieses Lied:
Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
dass sich wunder alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.
(EG 4,1)
In reformatorischer Perspektive ist das ganz zentral: In Jesus Christus hat Gott sich so auf die Menschen eingelassen, dass er alles, was die Menschen von ihm trennte, hinweggenommen hat. In Christus hat Gott zum Heil der Menschen gehandelt, er hat die Sünde und den Tod als von Gott Trennendes ein für alle Mal weggenommen. Weil in Jesus Christus Gott umfassend und für alle Menschen gehandelt hat, betont Luther: Jesus Christus allein ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Mit der Formel „Christus allein“ – lateinisch solus Christus – erinnern die Reformatoren an diese besondere Bedeutung und Exklusivität Jesu Christi.
Das Arrangement ist gefärbt vom expressiven Tango Nuevo.
9. JOANNES HUSSEN LIED / JESUS CHRISTUS UNSER HEILAND
Komp.: Johann Hus, Luther
Arr.: Lucas M. Schmid
Jesus Christus, unser Heiland,
Der von uns den Gotteszorn wandt,
Durch das bitter Leiden sein –
Half er uns aus der Höllen Pein.
(nicht im EG)
Sola gratia etc. – aber nicht Solo Luthero.
Luther befand sich in guter Gesellschaft: Philipp Melanchthon hat für die Entwicklung der Bildungsinstitutionen nicht nur im deutschen Raum eine entscheidende Bedeutung. Ulrich Zwingli hat die Verbindung von Reformation und Freiheit in der Züricher Bürgerschaft Gestalt werden lassen. Johannes Calvin begründete die Internationalität der Reformation durch seine Einbindung von französischen und anderen europäischen Traditionen. Die reformatorische Bewegung aber hätte sich nicht so rasant entwickelt, wenn nicht Landesfürsten wie Friedrich der Weise von Sachsen oder Philipp von Hessen sie gefördert hätten und die Bürgerschaften von Städten wie Zürich, Hamburg und Genf.
Es waren aber nicht nur diese Herrscher und Theologen, sondern ganze Netzwerke verbundener Männer und Frauen, die das reformatorische Zeitalter möglich machten und prägten. Im größten Reformationsdenkmal der Welt, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Worms erbaut wurde, kommt das dadurch bildlich zum Ausdruck, dass dort neben den klassischen Reformatoren und den genannten Landesfürsten auch sogenannte Vorreformatoren wie Johannes Hus (1369-1415) abgebildet sind.
Von ihm stammt das nächste Lied.
Die Melodie dieses Liedes ist in der Urform klar strukturiert. Obwohl auf dem Notensystem keine Taktstriche eingezeichnet sind, läßt sich die Melodie in eine gerade Taktart, in diesem Falle in einen 6/4 Takt und in zwei Dreiergruppen, einteilen. Grundlage für das einfache Muster des Rhythmus war die klare Aussage von Luthers Text. Gegensätze wie „hell“ und „dunkel“ im Text werden musikalisch mit forte und piano sowie durch die verschiedenen Soloimprovisationen umgesetzt.
10. L. DER REBELL
Komp./Arr.: Lucas M. Schmid
Dieses Musikstück hat Lucas Schmid Martin Luther gewidmet, einem Menschen, der Stärke und Schwäche extrem auslebte, und es verstand Visionen zu verwirklichen.
Aber wie ist das nun mit Luther und Jazz, ja mit Gott und Jazz.
„Gott kann kein Jazz“ – so hieß eine Rezension der Platte „Wynton Marsalis and Eric Clapton play the blues“, die 2011 erschien. Ich meine: Das stimmt so nicht.
Von der Jazz-Sängerin Sarah Kaiser habe ich den Satz gehört: „Jesus ist Pop“. Pop, die Kurzform von Populär, kommt vom lateinischen Wort „populus“. Und das heißt: „das Volk, die Leute, die Menschen“. Zu Weihnachten feiern wir Jesu Geburt. Gott wurde Mensch. Wurde populus, wurde populär.
Alles begann ja mit der Schöpfung. Gott schuf den Menschen und sah ihn an und „siehe, alles war sehr gut“. Doch dann kam mit dem Sündenfall alles ganz anders als geplant. Gott musste reagieren. Musste improvisieren. Und tat das, indem er Mensch wurde. Wenn es in einer Musikart um das Improvisieren, wenn es in einer der vielen Formen der Gottesgabe Musik um die Improvisation geht, dann im Jazz.
Was ist denn Improvisation? Wenn ich es recht verstehe, ist Improvisation der kreative, spontane und subjektbestimmte Umgang mit dem, was vorgegeben ist. Ist Gott nicht kreativ, ist der Schöpfer nicht schöpferisch? Und ist nicht Gott der Inbegriff der Einheit von Form und Freiheit, Komposition und Inspiration? Ist Gott nicht Grund allen Lebens, und Leben nicht immer auch Improvisation?
Gott kann kein Jazz? Er kann es wohl!
Die kreative, spontane und individuelle Verarbeitung der Tradition lässt sich auch bei Martin Luther finden. Die Reformation kann man ja unter vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich deute sie als ein religiöses Ereignis. Denn in ihrem Zentrum steht die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu Gott. Luther war wie die anderen Reformatoren davon überzeugt, dass Gott selbst den rechten Glauben wecken und so das Verhältnis zu Gott erneuern werde.
Im Mittelpunkt seines Denkens steht der Begriff der Rechtfertigung. Ein Wort, das sich heutzutage nicht von selbst versteht. Was es bedeutet, können wir vielleicht noch anhand der Redewendung „Gnade vor Recht“ verstehen. Ein Mensch, der nach Recht und Gesetz zu verurteilen ist, darf doch auf Gnade oder auch Begnadigung hoffen. Solche Formen der Vergebung „allein aus Gnaden ohne des Gesetzes Werke“ (Röm 3,28) kennen wir auch heute, selbst wenn sie in unserem Rechtssystem anachronistisch wirken.
Der Mensch wird nicht bemessen nach dem, was er nach außen darstellt oder auch wie er persönlich dasteht, sondern er wird von Gott geliebt, anerkannt, gewürdigt, ganz unabhängig von seinem Bildungsstand, Einkommen, sozialen Hintergrund und gesellschaftlichen Ansehen. Diese Anerkennung oder Würdigung macht den Menschen wahrhaft frei. Schuld belastet ihn nicht mehr, ist aber auch nicht einfach vergessen, sondern ist als bekannte Schuld vergeben und dadurch überwunden.
Genug der Predigt. Wir merken, wie unsere Worte nur um das kreisen können, was Gott für uns ist. Wir können ihn nicht festlegen mit unseren Gedanken, können ihn nicht definieren mit dem, was wir sagen.
Das letzte Wort hat deshalb die Musik.