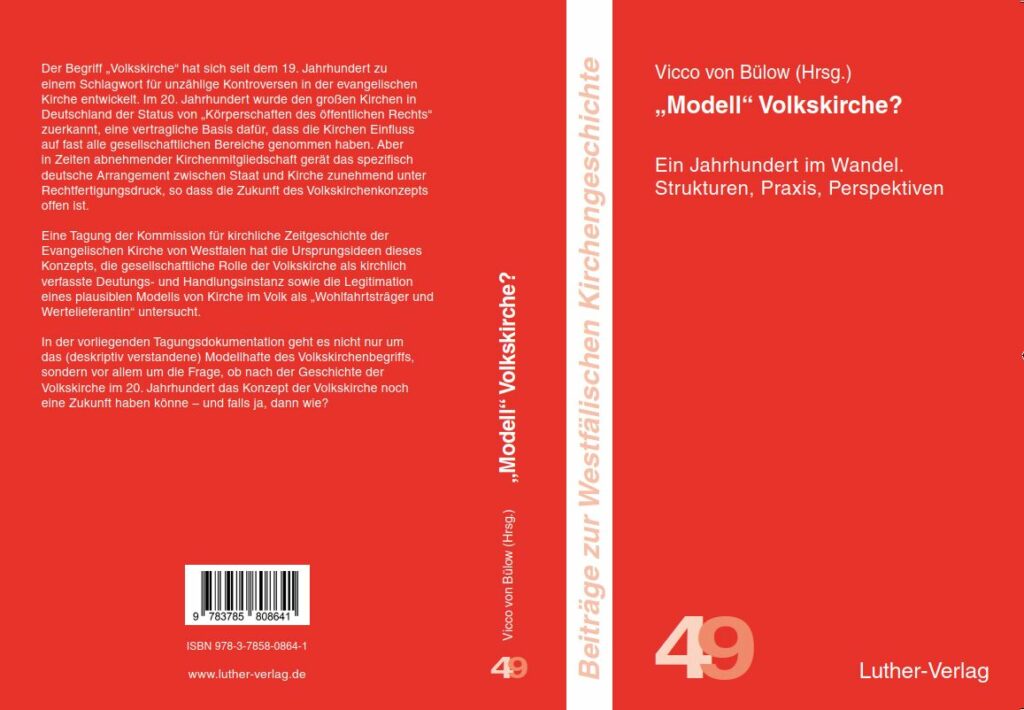Predigt für die Ev.-Luth. Martini-Kirchengemeinde Gadderbaum
am 5. November 2023
im Vortragssaal der Kunsthalle Bielefeld
Liebe Gemeinde!
Respekt!
Heute hat der Gottesdienst nicht nur bereits um Punkt 10 Uhr begonnen statt wie in unserer Gemeinde üblich um halb elf. Wir versammeln uns auch nicht in der Stephanuskirche, sondern in der Kunsthalle.
Andere Zeit, anderer Raum. Und Sie sind da! Wie wundervoll. Genau das habe ich heute morgen gebraucht.
„Was wir brauchen“ – so heißt die Ausstellung, die in den Etagen über uns zu sehen ist. Vor allem mit Ausstellungsstücken von Oscar Tuazon.
Oscar Tuazon ist ein US-amerikanischer Installationskünstler und Bildhauer, der in Los Angeles lebt. Er wurde 1975 geboren. Die renommierte Internetseite Artfacts.net zählt ihn zu den 1000 bedeutendsten Künstlern weltweit und bezeichnet ihn als „ultra-contemporary“, also als ultra-zeitgenössisch.
Auf Wikipedia steht: „Die raumgreifenden Konstruktionen von Oscar Tuazon befinden sich auf der Schnittstelle zwischen Skulptur, Architektur und Design. Häufig verwendete Materialien sind Holz, Metall, Stein und Beton. “
Mit einigen seiner Werke ist Tuazon gerade sozusagen „auf Europatournee“. Zunächst in der Kunsthalle Bergen, dann im Kunst Museum Winterthur, und jetzt eben in Bielefeld – und das noch eine Woche lang.
Auch wenn Sie die Ausstellung selbst noch nicht besucht haben, haben Sie eines seiner Kunstwerke bereits gesehen. In der Eingangshalle steht mitten im Raum „Where I lived and What I Lived For“ (2007), ein Anklang an ein früheres Werk, das Native American Pavillon. Tuazon fühlt sich den uramerikanischen Bewohnern der US-Westküste sehr verbunden und hat viel von ihrem ganzheitlichen Kunstverständnis übernommen:
Mich inspiriert nach wie vor eine erweiterte Vorstellung von Kultur, wie sie in indigenen Communitys vorherrscht, das heißt ein Konzept, das neben bildender Kunst auch Musik, Nahrung, Sprache und Zeremonien einschließt.
Zu dem, was wir ganz grundlegend brauchen, gehört für Oscar Tuazon das Wasser. Die Water School in der ersten Etage ist ein sichtbares Zeichen dafür.
Mit dieser Installation hat sich Tuazon am politischen Protest der sogenannten Water Protectors gegen eine Wasser-Pipeline durch indigenes Land beteiligt. [Alle Zitate von Oscar Tuazon nach dem Gespräch mit Benedikt Fahrschon, Lynn Kost, Christina Vegh und Axel wieder, das unter dem Titel „Lernen, bauen, denken“ im Katalog zur Ausstellung veröffentlicht wurde.]
Als Künstler habe ich manchmal das Gefühl, in Isolation zu arbeiten – und hier waren 10 000 Menschen, die sich zusammengetan hatten, um temporäre Gebilde zu errichten, mit denselben Mitteln, die auch ich nutze. In Umweltbewegungen unter indigener Führung gilt Kultur nicht als zweitrangig gegenüber politischer Organisation, sondern als zentraler Baustein des Gesamtprojekts.
Wasser ist grundlegend für alles Leben auf der Erde. Auch die Bibel weiß das – wie es schon die Schöpfungsgeschichte zeigt, die wir als biblische Lesung gerade gehört haben. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, dem einzigen Element, dass sich im Tohuwabohu schon identifizieren ließ.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde; ihm verdanken sich der Kosmos, die Biosphäre, das organische Leben und schließlich der Mensch,
Zunächst einmal werden die Räume geschaffen, in den dann Leben entstehen kann. Ein durchaus moderner Gedanke. Die aktuellen Debatten um den Naturschutz befassen sich neben dem Artenschutz auch mit dem Schutz ganzer Lebensräume, den Biotopen. Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass man die Lebens-Räume schützen muss, wenn man das Leben schützen will.
Dazu gehört auch der Klimaschutz. Darüber sind sich auch irgendwie alle einig, aber ob wir genug dafür tun und wie man darauf aufmerksam machen kann, darüber schon wieder nicht.
Gerade radikalere Gruppen treffen mit ihren Aktionen oft auf Unverständnis, seien es nun Straßenblockaden oder Attacken auf Kunstwerke. Oscar Tuazon dagegen zeigt sich als politischer Künstler, eben als „ultra-zeitgenössisch“:
Kunst ist eine Sphäre, in der wir sehr kritisch über den Abfall nachdenken müssen, den Ausstellungen, Reisetätigkeiten und die Kunstwerke selbst hinterlassen. Deshalb sind Klimaproteste, die sich berühmter Kunstwerke bedienen – mögen diese Aktionen auch viele Menschen wütend machen -, so wichtig und effektiv: Sie instrumentalisieren die symbolische … Macht eines Kunstwerks.
Tuazons Kunstwerke wie zum Beispiel die Skulptur „Numbers“ (2012) als Ziele von Kartoffelbrei-Attacken? Ich weiß nicht, wie die Kunsthalle Bielefeld darauf reagieren würde…
Wenn Sie sich seinen Skulpuren nähern, um sie herumgehen, werden Sie auf jeden Fall neue Perspektiven entdecken. Zum Beispiel auf die dahinter an den Wänden angebrachten Kunstwerke (von Richard Serra und anderen). Aber auch darauf, wie wir Räume wahrnehmen.
Das ist für mich das Spannendeste an der manchmal etwas spröden Konzeptkunst von Oscar Tuazon. Sein Verständnis von Räumen und wie man sie nicht nur nutzen, sondern auch prägen kann.
Ich schaffe Räume für Menschen. Ich mache Platz, damit etwas anderes passieren kann. … Einen Raum zu betreten, ist nicht nur … eine Erfahrung für einen Betrachter, sondern auch eine soziale und politische Handlung, die ihrerseits die Bedingungen des Raums schafft. Du machst den Raum.
Am deutlichsten wird das in seinem zentralen Ausstellungsstück in der Kunsthalle:
Dem „Building“, das speziell für diesen Raum in Bielefeld entworfen und hergestellt wurde. Site-specific art nennt das die Kunstexperten.
Maßstäblich verkleinert stellt das „Building“ das Gerüst eines Hauses in den amerikanischen Wäldern dar, das Tuazon mit seiner Familie bewohnt, wenn er nicht in L.A. ist. Entscheidend ist aber für ihn nicht das Gerüst, sondern das, was darinnen passiert, das, was Menschen daraus machen.
Man kann kaum ein schöneres Geschenk machen, als zu sagen: „Hier ist die Arbeit, sie ist unvollendet; es gibt noch so viel, was du machen kannst.“
In der Mitte steht ein Feuerofen, um den herum sich Menschen versammeln können.
Und deshalb sind als einziges konkretes Einrichtungsstück im „Building“ Bänke installiert. Die Neue Westfälische führt auf ihnen Kunstgespräche. Die Universität Bielefeld und die Technische Hochschule OWL führen dort Lehrveranstaltungen durch, die diese Bänke zu Hörsaalbänken machen.
Bänke bringen Menschen zusammen, das wissen wir in der Martini-Gemeinde spätestens seit unserem Projekt „Plauderbank“.
Und es gibt noch weitere kirchliche Parallelen zu Tuazons Raumverständnis. Oft wird ja der Kirchenraum als heiliger Raum für den Gottesdienst verstanden.
Der evangelische Kirchbauexperte Thomas Erne hat auf biblische Vorbilder verwiesen:
Das sind Traditionslinien, die sich bis ins Alte Testament verfolgen lassen. Dort finden sich die räumliche Gegenwart Gottes im repräsentativen Tempel und die kommunikative Gegenwart Gottes in der Liturgie der Synagoge. …Die Synagoge ist ein Funktionsraum, dessen Bedeutung in der Ermöglichung der liturgischen Feier aufgeht.
Anders als die katholische Theologie haben wir Evangelischen einen zumeist nüchternen Blick auf den Raum der Kirche:
Kirchengebäude sind bis heute in evangelischer Perspektive äußerer Rahmen für die gottesdienstliche Zusammenkunft und letzten Endes entbehrlich. Deshalb kann Gottesdienst auch gefeiert werden „auf einem Platz unter dem Himmel, und wo Raum dazu ist“, wie es Martin Luther einmal gesagt hat.
Auf einem Platz unter dem Himmel, oder wo Raum dazu ist. Die feiernde Gemeinde macht jeden Raum zu einem Gottesdienstraum, nicht der Kirchraum umgekehrt die feiernde Gottesdienstgemeinde.
Dieses Motiv einer Unabhängigkeit der christlichen Religion von Räumen ist in der Evangelischen Theologie ein Grundkonsens von Luther über Schleiermacher bis heute: „Die Umgrenzung des Raumes ist nur eine äußere Bedingung, mithin Nebensache“.
Heilig ist ein Raum, auch ein Kirchenraum, also nicht einfach so, durch Tradition oder durch ein bestimmtes Architekturkonzept. Heilig ist ein Raum, auch ein Kunsthallenhörsaal, dadurch, dass Menschen ihn zum Gottesdienst nutzen. Sie haben es vielleicht noch nicht gemerkt, aber wir befinden uns gerade in einer Kirche.
Liebe Gemeinde,
in den letzten Monaten hat es viele Gemeindeversammlungen zum „Aufbruch 2035“ gegeben. Dem Veränderungsprozess der Kirche in Bielefeld. Der nötig ist, weil wir auch in Bielefeld immer weniger Kirchenmitglieder und immer weniger Geld haben. Und weil die kleiner werdenden Kirchengemeinden und geringer werdenden Finanzmittel nicht mehr zu den vielen Gebäuden passen, die wir noch haben. Und auch wenn ich durchaus mitbekommen habe, wie anstrengend die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden in der Innenstadtregion manchmal ist, ich halte sie für unvermeidbar.
Wir werden Ressourcen miteinander teilen müssen – und zu diesen Ressourcen gehören auch unsere Räume. Es gibt keinen an sich heiligen Raum Süsterkirche, die Altstädter Nicolaikirche ist trotz des schönen Altars nicht per se heilig und die Neustädter Marienkirche ist vielleicht dann am heiligsten, wenn sie als Vesperkirche oder für geistliche Musikkonzerte genutzt wird. Und so sehr ich die Stephanuskirche mit ihrem Zeltdach und den wunderschönen Buntglasfenstern liebe – auch sie ist vor allem ein Funktionsraum, dessen Bedeutung darin besteht, dass er die Feier eines Gottesdienstes ermöglicht. Natürlich sieht die Stephanuskirche ganz anders aus als das „Building“ von Oscar Tuazon. Aber im Endeffekt ist auch sie nur ein äußerliches Gerippe, in dem das Entscheidende geschieht durch die Menschen, die sich darin versammeln.
Zum Glück tun sie das. Zum Glück tun wir das. Und insofern sind wir als Gemeinde, wir, die wir heute hier in der Kunsthalle versammelt sind, wir sind das, „was wir brauchen“, um den Titel der Ausstellung noch einmal aufzunehmen.
Und vielleicht nehmen wir auch noch eine Anregung von Oscar Tuazon mit auf:
„Kann ich zum öffentlichen Raum etwas Nützliches beitragen? Das scheint mir ein guter Ansatzpunkt zu sein.“
Ja, das scheint mir ein guter Ansatzpunkt auch für uns in der evangelischen Kirche, für uns in der Martini-Gemeinde zu sein: Können wir zum öffentlichen Raum etwas Nützliches beitragen? Können wir für unsere Bielefelder Gesellschaft etwas Gutes tun? Oder mit der Bergpredigt gesprochen: Können wir Salz der Erde und Licht der Welt sein? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können. Und deshalb ist mir nicht bange um die evangelische Kirche in Bielefeld und nicht um die Martini-Gemeinde, ob nun im Blick auf 2035 oder darüber hinaus. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir werden nicht so bleiben, wie wir sind.
Wir werden neue Wege gehen. Und auf die will ich vertrauen.
Amen.